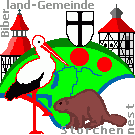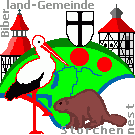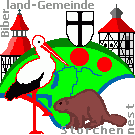
|
Ein kleiner Beitrag zur Dorfgeschichte von
Buro und Klieken
|
|
Teil
7 ( Die Zeit nach 1945 )
|
|
| Ein neuer Anfang in Klieken und Buro |
| Die Bodenreform |
Unter einer Bodenreform versteht man
den zwangsweisen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse von Grund
und Boden. Aus sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gründen
werden die bis dahin geltenden Besitzrechte geändert. Bereits im
August 1945 nahm die Führung der Kommunistischen Partei
Deutschlands (KPD) Kurs auf die radikale Umgestaltung der
Besitzverhältnisse auf dem Land. Die Provinz Sachsen erhielt dabei
eine wichtige Schlüsselrolle. Agitatoren der KPD zogen durch die
Dörfer der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), um unter den
Losungen "Junkerland in Bauernhand", "Was 1525 endet in Blut und Verrat
- Ward 1945 vollendete Tat" oder "Nehmt den Junkern ihren Raub" die
entschädigungslose Enteignung jeglichen Grundbesitzes über
100 Hektar zu propagieren. Der Vorsitzende der KPD, Wilhelm Pieck,
leitet dann am 2. September 1945 mit seiner Rede in Kyritz (
Brandenburg) die Durchführung der Bodenreform in der SBZ ( ab
7.10.1949 DDR ) ein. Die Bodenreform wurde als Voraussetzung zur
Ausrottung des Faschismus und Militarismus mit ihren gesellschaftlichen
Wurzeln propagiert. Insgesamt fielen 3,3 Millionen Hektar, also rund
ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Sowjetischen
Besatzungszone, unter die Bestimmungen der Bodenreform.
Die Verwaltung der
Provinz Sachsen beschloß bereits am 3. September 1945 die
Verordnung über die Bodenreform. Die anderen Länder der
Sowjetischen Besatzungszone schlossen sich bis zum 11. September mit
fast gleichlautenden Verordnungen an. Die SMAD nahm mit Hilfe der KPD
die Umsetzung der Bodenreform fest in die Hand und kontrollierte die
Kommissionen. Ein scheinbar demokratischer Anstrich sollte gwahrt
bleiben. Demokratisch war die Bodenreform jedoch nicht. Gerichtliche
Rechtschutzmöglichkeiten gab es nicht. Auch die Einstufung als
Kriegsverbrecher oder aktiver Nationalsozialist unterlag in keiner
Weise einer gerichtlichen Kontrolle. Gegen Entscheidungen gerichtlich
vorzugehen war also nicht möglich. Es war eine "verordnete"
Bodenreform. Die kommunistische Partei setzte die Enteignung brutal
durch. Die offiziell verkündeten Ziele waren : |
-
das Ackerland der bereits bestehenden Bauernhöfe unter 5 Hektar zu
vergrößern.
- neue, selbständige Bauernwirtschaften für landlose Bauern,
Landarbeiter und kleine Pächter zu schaffen.
- Umsiedler und Flüchtlinge, die als Folge der deutschen
Kriegspolitik ihr Hab und Gut verloren hatten, sollten wieder eigenes
Land erhalten.
- zur Versorgung der Bevölkerung in der Nähe der Städte
Wirschaften zu schaffen, die der Stadtverwaltung unterstehen. Zum
Zwecke des Gemüseanbaues sollen Arbeiter und Angestellten
Landparzellen erhalten.
Entschädigungslos wurde enteignet, wer mehr als 100 Hektar Land
besaß oder wer ein Nazi -oder Kriegsverbrecher war. Letztere
wurden auch enteignet, wenn sie weniger als 100 Hektar besaßen.
Die Losung lautete: "Junkerland in
Bauernhand"
Sehr empfehlenswerter Link:
http://www.bodenreform-schwarzbuch.de
Bildquelle:
http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/ddr/ddr_propaganda_001.jpg
|
 |
|
In
den Gemeinden wurden bis zum 15. September
Gemeindebodenkommissionen, die aus 5 bis 7 Personen zu bestehen hatten,
installiert. Sie setzten sich aus Landarbeitern, landarmen Bauern unter
5 ha und am Orte wohnenden Umsiedlern zusammen. Das zu verteilende Land
sollte nicht über 5 Hektar betragen, nur bei schlechter
Bodenqualität 8 ha. Die neu eingerichteten Wirtschaften waren
schuldenfrei. Sie durften jedoch nicht verkauft, verpachtet oder
verpfändet werden. Die Maschinen der enteigneten Betriebe
erhielten "Komitees der gegenseitigen Bauernhilfe" zur gemeinsamen
Nutzung.
Der Kommission in Buro gehörten folgende Personen an: Paul
Müller, Franz Mähne, Franz Neute, H. Otterberg, August Radon
und Paul Clemens. Die Staatlichen Domäne in Buro umfaßte 644
Hektar. Der Domänenboden wurde an Landlose, Umsiedler und
Einheimische verteilt. Insgesamt wurden hier in Buro 39
Neubauernstellen geschaffen. 15 Neubauernhöfe wurden neu gebaut.
Die Verteilung war bereits Mitte November abgeschlossen. Auch
verschiedene Kleinstbauern wurden in Ihrem Besitz "aufgestockt". Die
Vermessungen dauerten bis zum Februar 1946 an.
Die Bodenkommission in Klieken wurde in den ersten Septembertagen 1945
gebildet und hatte ihre erste Sitzung am 19. September. 68 Familien,
vorwiegend kinderreiche Flüchtlingsfamilien, meldeten sich, um
Land zu erhalten. Vorsitzender der Kommission war der Kommunist Wilhelm
Herzbruch. Weitere Mitglieder waren: Wilhelm Mohaupt, Paul Große,
Karl Arndt, Wolfgang Stanz, Paul Lorisch und Paul Oblijewski.
Letzter Besitzer des Rittergutes ( Unterhof ) in Klieken war
Generalmajor Richard Ernst Bernhard von Oppeln-Bronikowski. Der letzte
Pächter des Oberhofes, auch Klosterhof genannt, war Alois Schmitz.
Die Besonderheit von Klieken bestand darin, daß es keine Bauern
gab. Nur Landarbeiter, Mägde und Knechte, die völlig von den
Herrschaften der beiden Güter abhängig waren, fristeten ein
armseliges Dasein. Klieken zählte zu den ärmsten Dörfern
in Sachsen-Anhalt und war bis zum Ende des 2.Weltkrieges der Inbegriff
für "das Ende der Welt". Holprige Straßen mit niedrigen
Katen aus Lehm, Holz ,Schilf und Stroh und ohne jeglichen Komfort
kennzeichneten über Jahrhunderte das Straßenbild des
Gutsdorfes. Eine Zählung der Einwohner im Sommer 1945 ergab 345
Kliekener. Ganze 6 Bürger besaßen ein Privathaus.
Außerdem existierten zwei Gaststätten eine Schmiede, und
eine Bäckerei.
Die 858 Hektar des
Unterhofes derer von Oppeln - Bronikowski wurden aufgeteilt. Der
Beschluß dazu wurde auf einer öffentlichen
Einwohnerversammlung am 5. Oktober 1945 gefaßt. Die Aufteilung
des 1116 ha umfassenden Klostergutes (Oberhof) verzögerte sich.
Die frühere Verflechtung des Klostergutes mit der Klosterkammer
Hannover war unklar. Nach einigen Überprüfungen wurde auch
der Oberhof am 1. März 1946 zur Verteilung freigegeben. Der
Oberhof wurde schließlich nicht als kirchlicher Besitz anerkannt,
was einer Enteignung im Wege gestanden hätte. Nach einem Bericht
vom 23. Juli 1946 geht hervor, daß zu diesem Zeitpunkt die
Enteignung beider Güter abgeschlossen war. Der Anfang für die
Neubauern war auch in Klieken sehr schwer. Das Dorf zählte jetzt
bereits 625 Personen von denen 257 Umsiedler waren. Der gestiegenen
Bevölkerung stand ein sehr niedriger Tierbestand gegenüber,
der wie folgt aus diesem Bericht hervorgeht :
2 Milchkühe,2
Spannkühe, 3 Zugochsen, 4 Kälber, 6 Schweine, 42 Ferkel, 63
Pferde, 2 Fohlen, 57 Ziegen, 1 Ziegenbock, 54 Ziegenlämmer, 11
Schafe, 41 Gänse, 10 Enten, 197 Hühner, 4 Truten und 89
Kaninchen. |
In Klieken und Buro wurden so
insgesamt mehr als 2000 Hektar Grund und Boden mit dem dazu
gehörigem Wohnhäusern, Stallungen, Geräten und Vieh
enteignet. Das "Gutshaus" in Buro wurde abgerissen und aus den
gewonnenen Baumaterialien entstanden sogenannte "
Neubauernwirtschaften". Für die Neubauern bestand das
größte Problem in der Bespannung von Fuhrwerken und der
Bereitstellung von Landmaschinen. Ersatzteile fehlten und neue
Maschinen gab es praktisch nicht. Um diese Misere zu lindern, wurde
1947 in Klieken der Maschinenhof der Vereinigung der gegenseitigen
Bauernhilfe (VdgB) eingerichtet. 1949 wurde dort eine
Maschinenausleihstation ( MAS) gegründet. Aus der MAS ging dann
1955 die Maschinen -Traktoren - Station ( MTS) hervor, aus der sich
dann der Kreisbetrieb für Landtechnik ( KfL) entwickelte. Von
Anfang an waren die Maschinenhöfe der VdgB, die MAS und
später die MTS eine entscheidende Hilfe für die Bauern und
hier insbesondere für die Neubauern, die nur über wenig oder
gar keine Landtechnik verfügten. Diese Stationen waren die
Säulen der Mechanisierung der Landwirtschaft in der DDR bis zum
Abschluß der Kollektivierung 1960. Die Technik wurde so optimal
ausgenutzt und befähigte Bauern konnten dort als Traktoristen oft
im Schichtbetrieb arbeiten, ohne selbst teuere Landtechnik anschaffen
zu müssen. Das war praktisch auch kaum möglich, weil nur MAS
/ MTS und staatliche Güter beliefert wurden.
Alljährlich
wurde auch ein Druschplatz eingerichtet, auf dem die Bauern, die nicht
über eine eigene Dreschmaschine verfügten, gegen ein geringes
Entgeld ihre Getreidemahd ausdreschen lassen konnten. Als Maschinisten
für die Dreschmaschine wurden zuerst Arbeiter aus Coswiger
volkseigenen Betrieben eingesetzt. Das hat aber nicht lange gut
funktioniert und mein Vater Rudi Hummel und auch mein Onkel Reinhold
Krause waren dann dort einige Jahre als Maschinist tätig. Hin und
wieder soll es dabei auch zu Rangeleien und sogar Handgreiflichkeiten
der Bauern untereinander gekommen sein, weil sich einzelne
vordrängeln wollten. Das gipfelte in einer handgreiflichen
Außeinandersetzung bei der dann an einen geschädigten
Neubauern schließlich Rentenansprüche gezahlt werden
mußten und das noch, nachdem dieser bereits durch Flucht in den
Westen Buro verlassen hatte. Die Bauern mußten sich, um dort
dreschen zu dürfen, vorher in einer Liste beim Bürgermeister,
damals Hermann Bauer, eintragen. Ihnen wurde dann eine Druschzeit
zugewiesen. Diese Zeiten lagen in der Regel außerhalb der
Spitzenbelastungszeiten des elektischen Stromnetzes, also
hauptsächlich in den Abend- und Nachtstunden. Für die
selbständigen Bauern war das eine erhebliche Belastung, weil sie
praktisch Tag und Nacht arbeiten mußten. Der Druschplatz oder
auch Dreschplatz genannt befand sich in Buro am Ende der Prahlbreite,
einer Straße, die aus Neubauerngehöften bestand. |

Die ehemalige
Domäne in Buro.
(Vergrößerung durch Klick auf
das Foto)

Feldarbeit auf der Domäne
in Buro um 1940
Rudi Hummel im Juni
1954 auf einem Geräteträger
vom Typ RS 08/15 der MAS in
Klieken
(Vergrößerung durch Klick auf das Foto)
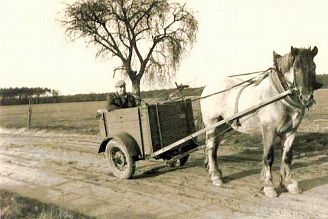
Heinz Brandt aus
Buro, Obstplantagenpächter
und Schäfer in Buro um 1960.
(Fotos: Rudi Hummel / 750 Jahre
Buro - Fotosammlung)
|
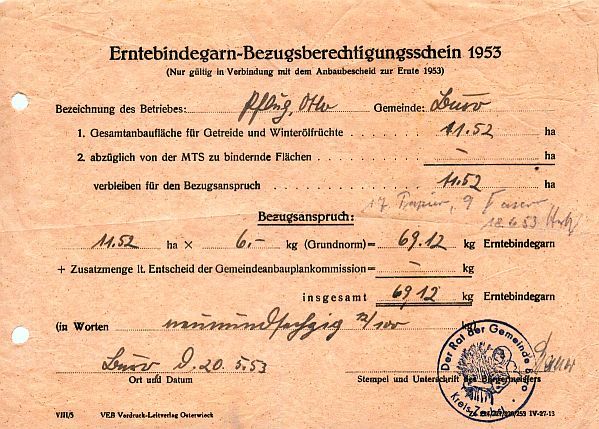
Wie prikär die Versorgung mit den notwendigsten
Hilfmaterialien für die Ernte war, zeigt der Bezugsschein
für Bindegarn vom 20.Mai 1953 für den Bauern Otto Pflug aus
Buro. Bewilligt wurden 17 Rollen Papiergarn und 7 Rollen Fasergarn.
( Zur Verfügung gestellt von Udo Pflug, Buro )
|
Wie lief zum Beispiel eine
solche Enteignung praktisch ab?
|
Mein
Großvater, Karl Krause, aus dem Nachbardorf Zieko besaß
ungefähr 120 Hektar Acker, Wiesen und Waldfläche und war
damit ein "Junker", der, wie 18 weitere großbäuerliche
Betriebe im Altkreis Roßlau, entschädigungslos enteignet
wurde. Er erinnerte sich in meiner Jugend wie folgt : "...die Lumpen
kamen am 30.November abends gegen Sieben und gingen durch unser Haus
und schrieben auf, was sie gebrauchen konnten. Ungefähr eine halbe
Stunde später sagten sie uns, daß wir umgehend nur mit etwas
Handgepäck vor dem Haus zu stehen hätten. Auf die Frage wohin
es ginge, sagte man uns "...Straflager oder Gefängnis!" Danach
wurden wir jedoch zum Bahnhof nach Coswig gebracht. Alle enteigneten
Bauern des Kreises verbrachten die Nacht dort. Am nächsten Tag
gegen 10.00Uhr fuhren wir mit dem Zug in Richtung Dessau ab und
verließen so befehlsgemäß das Kreisgebiet und sollten
es nie wieder betreten dürfen." Die Eintragungen seines Besitzes
im Grundbuch wurden später entweder entfernt oder geschwärzt.
Das bewegliches Hab und Gut verschwandt bis auf wenige Ausnahmen
spurlos. Sein Grund und Boden, der über Jahrhunderte im
Familienbesitz war, gehört heute zum größten Teil dem
"Rechtsstaat" Bundesrepublik, der damit diese undemokratische und
ungerechte Enteignung als Recht anerkennt und nachträglich sogar
Profit daraus schlägt. So etwas bezeichnet man strafrechtlich wohl
als Helerei. Die Enteigneten wurden wie Verbrecher behandelt. Eine
Rückkehr nach Zieko in ein zwischenzeitlich geerbtes Haus wurde
Ihm viele Jahre verwehrt. Fast auf den Tag genau 11 Jahre nach der
Enteignung, Ende November 1956, war es dann jedoch möglich, weil ,
wie er sagte, "...ein dusseliger Kommunist in Roßlau nicht
wußte was er da genehmigte".
Mit der entschädigungslosen Enteignung bäuerlichen Besitzes
wurden über Jahrhunderte gewachsene Strukturen vernichtet. Eine
ländliche Kultur mit häufig einmaligen Kulturgütern und
einer breit gefächerten Kulturlandschaft wurde über Nacht
ausradiert. Das Resultat sehen wir noch heute in Form verfallener und
heruntergewirtschafteter Besitzungen und im Fehlen von Verantwortung
tragenden Eigentümern, weil auch zwangsläufig Bindungen der
folgenden Generationen viel zu oft verloren gegangen sind. Die Schicksale der
Alteigentümer oder Pächter der Domänen sind heute oft vergessen. Sie
endeten allzu häufig in den Speziallagern des sowjetischen NKWD, wie in diesen
von Torgau, Mühlberg oder Buchenwald.
|
Die Bodenreform war eigentlich
nur die Vorstufe zur Kollektivierung der Landwirtschaft nach
sowjetischem Vorbild. Die Neubauern durften das ihnen zugeteilte
Land weder verkaufen, noch teilen oder belasten. Bodenreformland war
gebundenes Eigentum, welches im Agrarrecht der DDR „Arbeitseigentum”
genannt wurde. Die Zuteilung von Land sicherte vorerst die
Selbstversorgung und war so Überlebenshilfe für mehrere
hunderttausend Menschen. Bereits auf der 2. Parteikonferenz der SED
im Juli 1952 wurde die Kollektivierung der Landwirtschaft
beschlossen. Auf völlig freiwilliger Basis sollten sich Landarbeiter
und Bauern zu Produktionsgenossenschaften zusammenschließen und
dafür Unterstützung erhalten. Das Echo darauf war sehr verhalten.
Bauern, die vor wenigen Jahren erst Land erhalten hatten und mit
großen Mühen versuchten aus ihrem Besitz etwas zu machen, dachten
oft überhaupt nicht daran diesen Besitz wieder herzugeben. Freie und
unabhängige Bauern gab es eigentlich nicht, denn jeder bäuerlichen
Wirtschaft wurde in Abhängigkeit von der Betriebsgröße eine
Pflichtabgabe, das sogenannte Soll, vom Staat vorgeschrieben. Diese
Regelung war nur für kleine Wirtschaften von Vorteil, weil sie ein
vergleichsweise geringes Soll zu erbringen hatten. Sie konnten ihre
landwirtschaftlichen Produkte, die sie über ihre Zwangsabgabe
produziert hatten, als sogenannte "Freie Spitze" zu deutlich höheren
Preisen verkaufen. Die größeren Betriebe hatten oft erhebliche
Schwierigkeiten, ihr vorgegebenes Pflichtablieferungssoll zu
erreichen. So wurde seitens der Machthaber Druck auf die Bauern
ausgeübt und kontinuierlich erhöht. Mit Propagandaaktionen vor den
Höfen und Agitationstruppen wurden die "widerspenstigen und damit
zugleich reaktionären Bauern" für die Genossenschaft "überzeugt".
Eine wirkliche demokratische Diskussion über das Für und
Wider kam nicht in Betracht. Losungen und Kampfparolen prägten oft das Dorfbild.
Freiwillige Zusammenschlüsse mag es
schon gegeben haben aber nur durch den Druck der "führenden Kraft
der Arbeiterklasse" (SED) setzte sich die Kollektivierung in der DDR
durch. Bis 1960 war sie dann abgeschlossen.
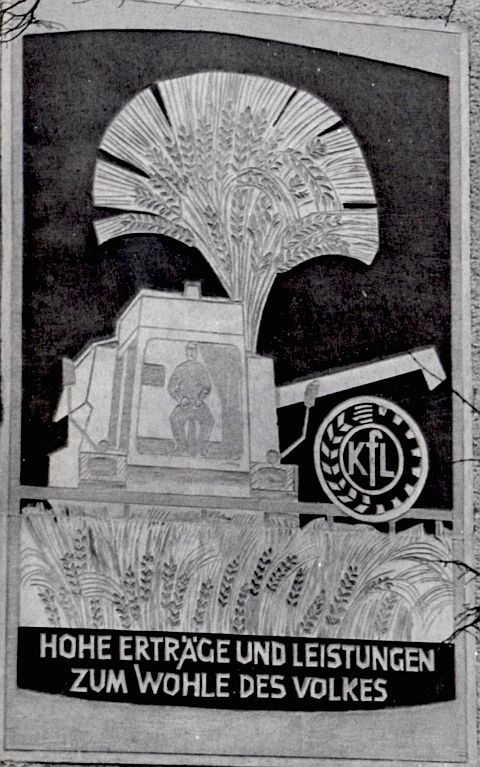 |
Im linken Bild eine Losung der Beschäftigten
im Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL) mit Sitz in Klieken.
Vorgänger in Klieken waren :
Maschinenhilfe der
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB)
MAS-
Maschinen-Ausleihstation,
MTS -
Maschinen-Traktoren-Station,
RTS -
Reparatur-Technische Stationen. |
|
(Fotoquelle: LPG Hermann Hagendorf-Klieken) |
|
Die
Kollektivierung der Landwirtschaft war also ein Weg, der viele
Emotionen und Widerstände in der bäuerlichen Bevölkerung
weckte und auch die Anzahl der Genossenschaften in den beiden
Dörfern zeigt, daß der Weg nicht einfach war. Viele Bauern sahen vor
1961 nur noch einen Ausweg für sich und ihre Familie - die Flucht in
den Westen Deutschlands.

|
| 1957. Durch Flucht in den Westen Deutschlands verlassener
Bauernhof in Buro.
(Fotoquelle: 750 Jahre Buro- Fotoausstellung) |
| |
Letzten Endes
war das Ziel der Kollektivierung aber schon 1952 durch die SED vorgegeben worden. Im Laufe
der Zeit setzte sich dann aber auch bei den meisten Bauern die Vorteile
der genossenschaftlichen Arbeit durch. Sie bestanden in der Hauptsache
in :
- großflächiger Gestaltung der Feld - und Wiesenflure.
- effektiver Nutzung eines großzügigen Landmaschinenparkes.
- Konzentration des Viehbestandes auf wenige Standorte .
- optimale Nutzung des züchterischen Fortschritts in der Tier- und
Pflanzenproduktion.
- geregelter Arbeitszeit und damit mehr Freizeit.
- Anspruch auf Urlaub, gesichertes Grundeinkommen ( LPG Typ III ).
- von den LPG vom Typ III wurden später erhebliche
finanzielle Mittel zur Verbesserung der sozialen Bedingungen in den
Dörfern bereitgestellt. |
 |
Lagebesprechung. Kartoffeln
legen in der LPG "Hermann Hagendorf" in Klieken um 1980.
(Fotoquelle:
750 Jahre Buro- Fotoausstellung) |
Die
Lebensqualität auf dem Dorf verbesserte sich erheblich und die
Menschen rückten auch wieder enger zusammen.
Anfangs wurden
mehrere Stufen von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
gebildet. Es gab den Typ I, II und III. Nur die Form vom Typ I und III
waren für Buro und Klieken von Bedeutung. Beim ersten Typ wurde
nur der landwirtschaftliche Grundbesitz gemeinschaftlich
bewirtschaftet. Das Vieh verblieb in den privaten Ställen. Beim
Typ III der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft wurde auch
das Vieh gemeinsam versorgt und genutzt.
|
So verlief die
Kollektivierung der Landwirtschaft in Buro und Klieken. Die Losung war
: " vom Ich zum Wir ".
Klieken:
Am 15. September
1952 Gründung der LPG (zuerst als Typ I) "Hermann Hagendorf". Bis
zum Mai der folgenden Jahres hatten sich in Klieken von den insgesamt
94 landwirtschaftlichen Betrieben 87 zu einer LPG zusammengeschlossen.
Im zweiten Halbjahr 1952 nahm die Anzahl der kollektiv bewirtschafteten
Betriebe wieder ab, so daß Ende 1953 noch 280 Hektar
genossenschaftlich bewirtschaftet wurden.
Am 26. September
1959 wurde unter dem Vorsitz von Gerhard Pest die LPG Typ I
"Fortschritt" mit 92 Hektar gebildet.
Am 5. April 1960
folgte die LPG Typ I "Freiheit" unter dem Vorsitz von Wilhelm Milde.
Ebenfalls am 5.
April 1960 entstand die LPG Typ I " Einigkeit " mit 10 Betrieben und 89
Hektar unter dem Vorsitz von Heinrich Weber.
Die Vereinigung
der drei landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom Typ I in
Klieken erfolgte am 13. Februar 1962. Der neue Name lautete LPG Typ I "
Goldene Aue". Den Vorsitz hatte Willi Leipe inne.
Buro:
Am 20.01.1953
wurde in der Schule in Buro die erste LPG Typ I mit 5 Betrieben
gegründet. Vorsitzender war Otto Schaaf. Bei Anwesenheit des
Vorsitzenden des Rates des Kreises Roßlau, Willi Harwardt,
erhielt sie den Namen " Fortschritt ". Die landwirtschaftliche
Nutzfläche betrug rund 50 ha. Mit der Jahresendabrechnung 1953
löste sich diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
wieder auf. In der Folge wurde Anfang 1954 ein ÖLB (
Örtlicher Landwirtschaftlicher Betrieb ) gebildet, der sogenannte
herrenlose Flächen bewirtschaftete. Der ÖLB bewirtschaftete
ungefähr 60 ha.
Am 1.4.1955 (Nach
anderer Quelle schon am 18.3.1955) wurde mit 15 Mitgliedern und zuerst
90 ha eine neue LPG Typ III unter dem Vorsitz von Otto Telle
gegründet. Sie erhielt den Namen " Junge Garde ". Ein Jahr
später baute diese LPG einen Rinderoffenstall - eine sowjetische
Erfindung, die stark propagiert wurde aber nur Probleme machte.
Gründung der
LPG Typ I "Elbeland" am 6. April 1960 unter dem Vorsitzenden Otto Pflug
(später Wilhelm Rüter). Damit war Buro ab 7.4.1960
vollgenossenschafllich. Eine Ausnahme bildete der Bauer Wilhelm
Gottschling der in keine LPG eintrat. Er wurde abfällig als
"Museumsbauer" bezeichnet. Ungefähr 63 ha wurden auch nach den
LPG-Gründungen noch weiter von Kleinstbetrieben in Buro
bewirtschaftet, die nicht genossenschaftlich organisiert waren. Die LPG
" Elbeland" vereinigte 13 landwirtschaftliche Betriebe mit zusammen 24
Mitgliedern. Bewirtschaftet wurden 157 ha. |
| Name |
Vorname |
Größe der Wirtschaft |
Strasse Nr. |
| Schwarz |
Adam |
14,8058 ha |
Kirschbaumreihe
Nr.52 |
| Schwarz |
Christa |
|
|
| Krause |
Robert |
|
Prahlbreite
Nr. 4 |
| Krause |
Erna |
|
|
| Pflug |
Otto |
14,72 ha
|
Winkel Nr.4 |
| Pflug |
Anni |
|
|
| Schulz |
Ewald |
|
Kiefernweg Nr.
|
| Schulz |
Martha |
|
|
| Görisch |
Otto |
24,0730 ha |
Mittelstrasse
Nr.17 |
| Görisch |
Erna |
|
|
| Rüter |
Wilhelm |
|
Kiefernweg Nr. |
| Rüter |
Marie |
|
|
| Friedrich |
Walter |
15,9472 ha |
Winkel Nr. 5 |
| Friedrich |
Edith |
|
|
| Kählitz |
Marie |
|
Winkel Nr.11 |
| Sackewitz |
Joachim |
|
Kiefernweg Nr.
30 |
| Sackewitz |
Anneliese |
|
|
| Friedrich |
Otto |
18,4772 ha |
Winkel Nr. 12 |
| Friedrich |
Liesbeth |
|
|
| Sukale |
Hermann |
|
Kirschbaumreihe
Nr. 56b |
| Sukale |
Martha |
|
|
| Hummel |
Martha |
|
Kirschbaumreihe
Nr.56 |
| Johannes |
Otto |
|
Hauptstrasse
Nr. |
| Johannes |
Else |
|
|
 |
 |
| Die
Getreidemahd mit einem Binder war ein gewaltiger Fortschritt in der
Landwirtschaft. |
Feldarbeit in
der Buroer Aue durch Genossenschaftsbäuerinnen der LPG Typ I
"Elbeland". (um 1965 ) |
 |
 |
| Getreideernte
um 1960. Martha Hummel stellt hier Garben zu einer Mandel auf. Eine
Mandel bestand aus 16 Garben. |
Else Johannes beim Rübenhacken
|
 |
 |
| Mist wird
ausgefahren. Achim Sackewitz in der Kirschbaumreihe. (um 1963) |
Die
Genossenschaftsbauern der LPG "Elbeland" Otto Johannes und Achim
Sackewitz verladen Dünger. (um 1965) |
 |
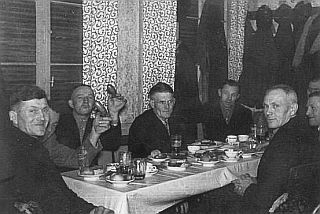 |
| Wilhelm
Friedrich mit einem Traktor der Marke "Pionier" zu Beginn der 1960-iger
Jahre. Die Mechanisierung der Landwirtschaft beginnt. |
Gemeinsam
arbeiten und ab und zu gemeinsam feiern. Jahresabschluß 1961. Die
Bauern der LPG Typ I in Buro: Robert Krause, Otto Johannes, Walter
Friedrich, Ewald Schulz, Otto Görisch, Otto Pflug und Wilhelm
Rüter (v.l.) (alle Fotos Rudi Hummel, Buro) |
 |
 |
|
Drillen in der Kliekener Aue. |
Die Frauen der betriebseigenen LPG-Großküche |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
Die LPG Typ III
"Junge Garde" in Buro, deren landwirtschaftliche Fläche inzwischen
auf 230 ha angewachsen war, vereinigte sich am 1. März 1960 mit
der LPG Typ III "Hermann Hagendorf" in Klieken zu einer Groß-LPG,
um zur Großflächenbewirtschaftung überzugehen. Zu
diesem Zeitpunkt bewirtschaftete diese LPG 864 Hektar. In Buro
arbeitete eine Komplexbrigade der Groß-LPG " Hermann Hagendorf"
mit 49 Arbeitskräften, die im Stall und auf dem Felde eingesetzt
waren.
Der Beitritt der
Genossenschaften "Elbeland" in Buro und " Goldene Aue" in Klieken wurde
dann am 1.Januar 1968 vorgenommen, so daß es dann für beide
Dörfer nur noch eine Produktionsgenossenschaft vom Typ III mit dem
Namen "Hermann Hagendorf" gab. Ziel war die sozialistische Umgestaltung der
Landwirtschaft. Am 1. Oktober 1965 wurde Buro ein Ortsteil von
Klieken. Seit dem 1. März 2009 gehören beide
Dörfer zur Stadt Coswig / Anhalt.
Mit der Vereinigung bzw. Übernahme der LPG "Elbeland" in
Buro in die LPG " Hermann Hagendorf" wurden für die aufgenommenen
LPG-Mitglieder Inventarbeiträge festgelegt, die diese zu
erbringen hatten.
|
| |
| |
| Bevölkerungsentwicklung beider Dörfer: |
| Jahr |
Klieken |
Buro |
Buroer Werder |
| 1833 |
- |
260 + |
|
| 1867 |
- |
309
+ + |
|
| 1897 |
- |
350* |
|
| 1910 |
437 |
385 |
137** |
| 1933 |
418 |
447 |
|
| 1939 |
390 |
483 |
|
| 1945 |
345 |
- |
|
| 01.06.1961 |
- |
532 |
|
| 1986 |
991 |
408 |
|
| 2004 |
1123 *** |
|
| 31.12.2005 |
1120 *** |
|
| 15.09.2010 |
771 |
336 |
|
| |
|
|
|
+ Quelle: Heinrich Lindner " Geschichte und
Beschreibung des Landes Anhalt" 1833 bei Chr. G. Ackermann, Dessau, S.
444 ff.
++ Quelle: Ferdinand Siebigk " Das Herzogtum Anhalt", Ortsbeschreibung
des Landes.
* Ouelle ist das Adreßbuch von 1897 für Buro und Domäne
** Der Buroer Werder war ein gemeindefreies Gebiet und wurde als
Domänenbezirk bei dieser Zählung von 1910 nicht erfaßt.
Hier waren am 1.12.1905 137 Bewohner ansässig.
*** Klieken und Ortsteile Buro, Schlangengrube und Werder
|
Nach dem 2. Weltkrieg setzte mit der Vertreibung der
Deutschen aus den
ehemaligen Ostgebieten des Reiches und aus dem Sudetenland ein Zustrom
der Bevölkerung ein, der sich insbesondere in der
Bevölkerungsentwicklung in Klieken niederschlug.
|
|
|
|
|
|